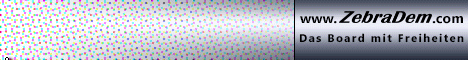Passt hier derbst hin:

Greez HB
Passt hier derbst hin:

Greez HB
Karlsruhe hat die Hand am Geldhahn
Karlsruhe - Eigentlich geht es nur um 21 Cent. Genau 1,09 Euro mehr an Gebühren hatte die dafür zuständige Kommission den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zum 1. Januar 2005 zubilligen wollen.
Davon blieben 88 Cent übrig, und auch erst zum 1. April 2005 - dank des Einsatzes dreier Ministerpräsidenten, die dem durch Steuern und Abgaben belasteten Bürger jene 21 Cent im Monat ersparten, also 2,52 Euro im Jahr.
ARD, ZDF und Deutschlandradio sind gegen die Gebührenintervention der Politiker vors Bundesverfassungsgericht gezogen. Dabei geht es weniger ums Geld als ums Prinzip. Denn die Aktion der beiden Unions-Landeschefs Edmund Stoiber (Bayern) und Georg Milbradt (Sachsen) sowie ihres damals noch in Nordrhein-Westfalen regierenden SPD-Amtskollegen Peer Steinbrück rührt ans Herzstück des öffentlich-rechtlichen Rundfunks – seine Unabhängigkeit. Wenn die Länder nach Belieben den Geldhahn auf- und zudrehen dürften, dann könnten sie die Sender gängeln – und im Endeffekt politisch willfährig machen. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 1994 den öffentlich-rechtlichen Anstalten ein ziemlich ausgeklügeltes Finanzierungssystem verordnet.
Zunächst melden die Sender ihren Finanzbedarf an, der auf einer zweiten Stufe von der unabhängigen Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) überprüft wird. Die Politik kommt erst auf der dritten Stufe ins Spiel - die Länder setzen die Gebühr per Staatsvertrag fest. An diesem Punkt wird es kompliziert: Zwar dürfen die Länder vom KEF-Vorschlag abweichen, aber nur unter strengen Voraussetzungen.
"Im Wesentlichen", so schrieb das Karlsruher Gericht 1994, sei das nur aus Gründen "des Informationszugangs und der angemessenen Belastung der Rundfunkteilnehmer" erlaubt. Die Politik darf also bremsen, wenn die Gebühr für die kleinen Leute unerschwinglich wird – umstritten ist, ob diese Grenze bei derzeit 17,03 Euro im Monat erreicht ist. Die klagenden Anstalten mutmaßen jedoch, dass Stoiber, Milbradt und Steinbrück etwas ganz anderes im Sinn hatten. Zunächst wollten die reformfreudigen Regierungschefs mit einem "SMS-Papier" - benannt nach ihren Initialen – den ganzen öffentlich-rechtlichen Rundfunk umkrempeln: Hörfunkprogramme sollten reduziert, Kultursender zusammengelegt und Sendezeiten begrenzt werden. Zwar sind den Ländern Reformen nicht grundsätzlich versagt – sie können per Staatsvertrag ganze Anstalten fusionieren, wie sie das im Südwesten mit dem SWR getan haben. Nur: Den Gebührenhebel dürfen sie dafür nicht ansetzen.
Im Staatsvertrag blieb von den Reformansätzen die neue Gebühr von 17,03 Euro übrig – doch dass sie zugleich Medienpolitik betreiben wollten, haben die Länder in der Begründung des Vertrags indirekt selbst eingeräumt: Sie hätten bei der Gebührenfestsetzung auch die "aktuelle Gesamtentwicklung der Aufgaben im dualen Rundfunksystem und im Wettbewerb der Medien insgesamt berücksichtigt", heißt es dort. Sollte die Gebühr also eine wettbewerbspolitische Maßnahme zu Gunsten des privaten Rundfunks sein? Nach dem Urteil 1994 wäre das unzulässig – Medienpolitik darf danach nicht über die Gebührenfestsetzung betrieben werden. (dpa)
Quelle: Digital Fernsehen
Gruß
das problem ist das die nicht aufhörn die leute zu betrügen ob staat oder gez
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!