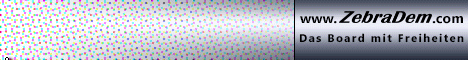Statt eines Nachrufes gibt Maik Söhler eine Empfehlung: «Weizenbaum. Rebel at Work» ist ein großartiger Dokumentarfilm über das Leben und Werk des nun verstorbenen Computerpioniers Joseph Weizenbaum.
Ich habe Joseph Weizenbaum zum Abschluss der Transmediale 2007 kennengelernt. Und zwar gleich in zweifacher Hinsicht. Als Hauptfigur von Peter Haas' und Silvia Holzingers dokumentarfilmischer Biografie «Weizenbaum. Rebel at Work». Und als streitbaren Mahner vor der Verbindung von Militär und Computern.
Weizenbaum war anwesend, als der Film über sein Leben und Wirken erstmals in Berlin-Mitte der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. 14 Wochen lang hatten die Filmemacher Haas und Holzinger den damals 84-Jährigen mit der Kamera begleitet, das rund 80 Minuten lange Werk sollte Teil einer Serie über «Software-Großväter» sein, wie sie einleitend sagten. Nach der Aufführung stellte sich Weizenbaum schließlich den Fragen des Publikums.
Es waren zwei Sätze Weizenbaums, die diesen Abend prägten. «Ich möchte einfach nur wissen, wie spät es ist, ohne dass du mir dabei die Uhr erklärst», lautet der erste. Eine der vier Töchter Weizenbaums hatte das mal gegenüber ihrem Vater geäußert und er gab den Satz wieder, kauzig und lächelnd, aber auch souverän-wissend.
Denn er hatte doch schon alles erklärt, wieder und wieder, in tausenden Vorlesungen, Seminaren und Vorträgen, auf Kongressen und Tagungen, in Europa und den USA, vor Jung und Alt, vor Laien und Fachleuten.
Die Ameisen
«Googeln Sie mal das Wort Ameise», lautete der zweite Satz. Das sagte Weizenbaum nach dem Film selbst. Das Publikum hatte so viele Fragen - zur Wissenschaft, zur Entwicklung der Technik, zur Person - und er mochte doch nur über eines sprechen: über die Gesellschaft. «Wenn Sie Ameise googeln, bekommen Sie wahrscheinlich eine Million und irgendwas Treffer», führte er weiter aus. Gut geschätzt, zumindest auf Deutsch. Da waren es, wie eine Suchanfrage bei Google am nächsten Tag zutage förderte, «ungefähr 727.000 für Ameise» (in 0,20 Sekunden), auf Englisch listete die Suchmaschine in deutlich weniger Zeit «63.000.000 für ant».
Wer nun wirklich so wahnsinnig ist, all diese Treffer zu sichten und auszuwerten, der wüsste vermutlich sehr viel über die Beschaffenheit der Ameise. «Aber darüber, wie die Ameise mit anderen Ameisen zusammenlebt, wüssten Sie immer noch wenig», führte Weizenbaum aus. Es war eine Parabel, die er präsentierte und die zeigen sollte, dass er nur auf die Zusammenhänge zu sprechen kommen wollte und eben nicht auf die einzelnen Teile: Wissenschaft, Technik, Person.
Die Weizenbaums
Zur Person hatte zuvor der Film schon vieles angedeutet. Wir sind auf der Leinwand dabei, wenn Weizenbaum über seine Kindheit in Berlin erzählt - dem Berlin der zwanziger und dreißiger Jahre, genauer: dem liberalen Berlin der Zwanziger, in dem die jüdische Familie Weizenbaum so gern lebte, und dem nazistischen Berlin der Dreißiger, das die jüdische Familie Weizenbaum wie alle anderen Juden nicht mehr haben wollte.
http://www.youtube.com/watch?v=dwxQtTtsSIQ
Ende des Jahres 1935 verlassen die Weizenbaums, die mit Pelzen handeln, ein eigenes Kürschnereigeschäft betreiben und die Joseph in seinen Erinnerungen zur «Upper Class» zählt, Deutschland mit einem Ozeandampfer in Richtung USA. Das wiederum unterscheidet sie von unzähligen anderen Juden, die nicht ausreisen konnten oder durften - ein Unterschied um Leben und Tod.
Der Neuanfang
Ein aus Deutschland mitgenommener teurer Persermantel wird zum Startkapital in Detroit, wohin es die Familie verschlägt, weil sie dort Verwandtschaft hat. Wie schon in Berlin bleibt das Verhältnis zum Vater schwierig, da Joseph nicht zurechtkommt mit dessen oft patriarchischer Haltung und der Geringschätzung von allem, was der Sohn unternimmt. Dennoch kommen die Weizenbaums auch in ihrer neuen Heimat wieder zu Erfolg und Ansehen, so dass Joseph Mathematik studieren kann.
Nach dem Studium folgt er einer Einladung ans renommierte Massachusetts Institute of Technology (MIT), wo er in der Folge von 1963 bis 1988 als Professor für Computer Science lehren wird. Dazu wie auch generell zu seiner wissenschaftlichen Arbeit, die zig von ihm entworfene Software und noch mehr Bücher - darunter auch den Bestseller «Computer Power and Human Reason» (deutsch: «Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft») - umfasst, schweigt der Film. Das erscheint einem anfangs seltsam, weil man auf diese Weise nur sehr wenig über die intellektuellen Leistungen Weizenbaums erfährt.
Der Wissenschaftler
Aber wer will, kann ja dem Ameisen-Vorschlag des Wissenschaftlers folgen und diesen Part googeln. Insgesamt gibt es rund 212.000 Treffer für Joseph Weizenbaum in 0,04 Sekunden. Man erfährt, dass Weizenbaum am MIT zu den Pionieren der Computertechnik zählte, sich sowohl mit Hardware als auch mit Software hervorragend auskannte und das ihn vor allem ein Programm namens Eliza berühmt machte.
Eliza war eine Frühform sprechender Software, ohne sie wäre AOLs in den neunziger Jahren berühmt gewordener Satz «You've got Mail» («Sie haben Post») nicht denkbar. Die Verbindung von Sprache und IT blieb Zeit seines Lebens eines seiner Hauptforschungsgebiete.
In zahlreichen Vorträgen präsentierte sich Weizenbaum außerdem als Gegner einer unkritisch-technizistischen Zukunftsgläubigkeit. Über das Internet prägte er einen seither viel zitierten Ausspruch: «Es ist ein Misthaufen. 90 Prozent sind Schrott, es finden sich aber auch ein paar Perlen und Goldgruben.»
Lachhafte Zukunft
All das überspringt der Film oder setzt es als bekannt voraus. Die Filmemacher gehen stattdessen dazu über, lange Interviewpassagen Weizenbaums mit Ausschnitten aus militärischen und zivilen Propagandafilmen der USA zu konfrontieren.
Diese Schnipsel zeigen eine in ihrer Naivität nicht zu toppende Verherrlichung von Wissenschaft und Technik. Mal steht der Hausfrau ein Roboter zur Seite, mal werden die Ingenieurwissenschaften als Inbegriff des Wortes «Challenge» («Herausforderung») gepriesen, utopisch-futuristische Welten, eine lachhafter als die andere, ziehen an uns vorbei.
Diesem Fortschrittsoptimismus der fünfziger und teilweise auch noch der sechziger Jahre folgt Weizenbaum nicht. Die engen Verbindungen zwischen Wissenschaft und Militär im Allgemeinen und zwischen dem Fachbereich Computer Science am MIT zur Luftwaffe im Besonderen erregen bei ihm Ärger und Abscheu. Er war zwar selbst von 1941 bis 1945 in den USA beim Militär, doch die Wissenschaft bleibt ihm eine «Quelle der Wahrheit» und soll nicht zum militärischen Erfüllungsgehilfen werden.
Militär und Computer
Es kommt natürlich anders, und Weizenbaum bleibt nur, zu erklären, was die Bedürfnisse einer Armee mit den immer kleiner und schneller werdenden Computern zu tun haben, nämlich fast alles. Es gebe sonst wohl kaum einen wissenschaftlichen Bereich, der so eng mit militärischen Entwicklungen verknüpft ist. Hardware und Software seien, wie er im Film sagt, ein integraler Bestandteil der «Möglichkeit zur Ausrottung der Welt».
Weizenbaum wirkt im Film desillusioniert, und dieser Eindruck verstärkte sich noch bei der anschließenden Diskussion mit ihm. Doch zynisch, deprimiert oder gebrochen war er deshalb noch lange nicht, obwohl sich das Militär weiterhin sämtliches Wissen aneignet, dessen es habhaft werden kann.
Weizenbaum in Berlin
Auch der Antisemitismus in seiner Wahlheimat Deutschland ist nicht verschwunden. Eine Kameraeinstellung zeigt ihn an der Marx-Engels-Statue am Berliner Alexanderplatz. Jemand hat Davidsterne darauf geschmiert. Dazu enthält sich der Informatikprofessor jeglichen Kommentars.
Die meisten der Interviewpassagen sind bei ihm zu Hause entstanden, in Berlin-Mitte, wo er seit 1996 wieder lebte. Sie zeigen ihn vor einem Bücherregal, er redet über den «Mythos der wissenschaftlichen Wertfreiheit», im Regal steht ein Roman von George Orwell neben einer Einführung in PalmPilot, aus dem Hintergrund sagt eine Computerstimme: «Sie haben Mail».
Ob er die Software für dieses Programm selbst schrieb? Spracherkennung war ja über Jahre eines seiner Spezialgebiete. Im Film kritisiert er die um sich greifende Verbreitung der Computersprache als «fatalen Weg», der vielleicht den Glauben stärkt, der Mensch sei nichts anderes als ein Computer auf zwei Beinen.
Besser als Google
«Weizenbaum. Rebel at Work» ist - technisch und künstlerisch gesehen – eher Mittelmaß. Eines aber zeigt der Film ganz deutlich: Wo der Wissenschaftler in den Hintergrund tritt, kommt der Mensch zum Vorschein. Und mit ihm viele der wichtigen Fragen, die man an Technik, Netzwelt, Gesellschaft, Politik und Kunst stellen kann und sollte.
Manchmal kommt eben doch alles zusammen: zu wissen, wie spät es ist, zu wissen, wie man die Zeit von der Uhr abliest und zu wissen, wie die Uhr funktioniert. Joseph Weizenbaum hat es uns im Film erklärt. Besser als Google es je könnte. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb Joseph Weizenbaum am Mittwoch im Alter von 85 Jahre nach schwerer Krankheit in Berlin.