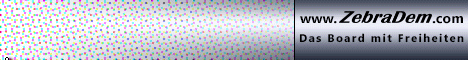Eine noch unveröffentlichte Studie der Neurowissenschaftler von der Universität Bremen hat gezeigt, dass Spieler zwischen virtueller und realer Gewalt unterscheiden können. "Killerspiele" werden bei Amokläufen oder anderen Gewalttaten oft als Ursachen betrachtet.
Die Wissenschaftler untersuchten 22 männliche Probanden in einem Magnetresonanztomographen. Die Testperson bekam zuerst Bilder einer virtuellen Gewaltaufnahme zu sehen, anschließend reale. Die Gehirnströme wurden dabei aufgezeichnet. Es stellte sich heraus, dass die Reaktionen in zwei vollkommen unterschiedlichen Teilen des Gehirns stattfinden.
Demnach regen Spielszenen eher einen Teil des Großhirns an - reale Gewaltszenen dagegen werden im limbischen System verarbeitet. Letzteres wird als Sitz emotionaler Verarbeitungsprozesse betrachtet. Die Wissenschaftler gehen deshalb davon aus, dass Intensivspieler auf der neuronalen Ebene zwischen virtuellem und tatsächlichem Geschehen differenzieren.
"Das Ergebnis ist ein starkes Argument gegen die Annahme, dass sich bei häufiger Nutzung von Gewaltspielen am Computer fiktionale und reale Szenen überlagern", erklärte der Co-Autor der Studie und Forschungsprojektleiter Thorsten Fehr gegenüber dem Magazin Focus. Offenbar findet keine Übertragung der Spiele in die Wirklichkeit statt.
Nebenbei zeigte sich, dass Spiele das räumliche Vorstellungsvermögen fördern. Dennoch übt der Neurowissenschaftler Kritik an Spielen wie Grand Theft Auto: Die Zeit, die junge Menschen mit derartigen Spielen verbringen, fehlt ihnen, um echte soziale Beziehungen aufzubauen.