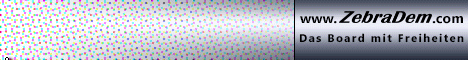[h=1]Transparenzregister greift nicht[/h] In den vergangenen Jahren hat sich Brüssel als Tagungsstätte der EU-Politik zu einer Drehscheibe lobbyierender Konzerne entwickelt. Vor allem große US-Unternehmen wie Facebook und Google bauen ihre Lobbyingaktivitäten in Brüssel enorm aus - gerade vor dem Hintergrund geplanter Datenschutzreformen. Gleichzeitig geben Kontrollinstrumente wie das Transparenzregister wenig Aufschluss über das Geschäft der Lobbyisten.
In seiner allgemeinen Begriffsbezeichnung hat Lobbying als Interessenvertretung die Funktion, Einfluss auf staatlich-politische Entscheidungen auszuüben. So viel zur trockenen Definition. Das Image von Lobbying ist allerdings ein denkbar schlechtes. Sein Ruf hat sich in Österreich in den vergangenen Jahren vor allem durch diverse Politskandale im Bewusstsein der Bevölkerung manifestiert.
[h=2]Früher London, Paris, jetzt Brüssel[/h]In Washington, das lange als das Lobbyzentrum galt, ist man laut einem Bericht des Onlinemagazins Politico der Reformstaus und der Starre von politischen Entscheidungen überdrüssig. Deshalb tummeln sich die Interessenvertreter zunehmend in Brüssel. Vor allem im Kartellbereich sei das zu beobachten, sagt Barry Steinhardt von Friends of Privacy USA. „Europa hat Unternehmen wie Google zu Entscheidungen bewegt, die US-amerikanische Regulatoren dem Internetkonzern nicht aufdrücken konnten.“ Aktuelles Beispiel ist die Datenschutznovelle, die laut Aktivisten in den USA unmöglich durchzubringen wäre.
„Ich bin seit 25 Jahren in Brüssel und habe beobachtet, wie immer mehr US-Firmen schrittweise ihre Hauptquartiere in Brüssel aufschlagen“, sagte Antoine Ripoll, Leiter des Vernetzungsbüros im EU-Parlament, gegenüber Politico. „Früher waren die Lobbyisten in London, Paris oder Deutschland. Jetzt ist es Brüssel.“
[h=2]US-Firmen beunruhigt durch Datenschutzreform[/h]Durch die neue Regulierung bekämen die 503 Millionen Bürger in der EU die Möglichkeit, digitales Tracking und personalisierte Werbung für sich auszuschalten. Das könnte die großen Technologieunternehmen aus den USA beim Verkauf von Werbedaten auf der Suche nach Konsumenten bremsen. Ein Szenario, das ein Lobbykarussell umtriebiger US-Firmen in Brüssel in Gang gesetzt hat. Deutlich abgeschwächt oder verwässert wurde die Regulierung bis dato aber noch nicht.
[h=2]Google und Facebook erhöhen Ausgaben[/h]Laut aktuellsten Daten des EU-Transparenzregisters stockte Google in Brüssel seine Lobbyingausgaben zwischen 2010 und 2011 von 500.000 Euro auf 700.000 Euro auf. Sieben Lobbyisten arbeiten für den Suchmaschinenbetreiber in Brüssel. Dass Washington und somit die USA von Lobbyisten komplett ignoriert werden, kann relativiert werden. Denn in den USA investierte Google im Jahr 2012 über 16 Millionen Dollar (etwa zwölf Millionen Euro) in Lobbying - rund 70 Prozent mehr als im Vorjahr, berichtete das IT-Magazin „Techcrunch“.
Facebook setzt als weltgrößtes Soziales Netzwerk drei Lobbyisten in Brüssel ein und investierte im Jahr 2011 etwa eine halbe Million Dollar (umgerechnet 370.000 Euro) in Lobbyaktivitäten, so die Daten laut American Chamber of Commerce to the European Union. Den eigenen Angaben im EU-Transparenzregister zufolge waren es 2011 lediglich zwischen 150.000 und 200.000 Euro. Für 2012 gab der Netzwerkriese bereits Kosten zwischen 350.000 und 400.000 Euro an. In den USA steigerte Facebook die US-Lobbyausgaben gleich um 196 Prozent auf vier Millionen Dollar (umgerechnet 2,9 Millionen Euro).
[h=2]Verwendungszweck weist auf EU-Lobbying hin[/h]Aus den Angaben zum Verwendungszweck der Lobbyinginvestitionen in den USA lässt sich schließen, dass die mit den Firmen kooperierenden US-Politiker auch auf ihre europäischen Kollegen Druck ausüben sollten. So nennt Facebook diese Tätigkeiten „international regulation of software companies“, also die „internationale Regulierung von Softwarefirmen“.
Der Suchmaschinenkonzern Google führte die Ausgaben unter „regulation of online advertising, privacy and competition issues in online advertising“ an, sprich „Regulierung von Onlinewerbung, Datenschutz und Wettbewerb bei Onlinewerbung“.
[h=2]Hauptinteresse laut Lobby: Arbeitsplätze[/h]In der Brüssler Rue de Luxembourg befindet sich das Büro der PR-Agentur Interel, die unter anderem Google zu ihren Kunden zählt. So soll sich Interel-Vorstand Catherine Stewart gegen weitere Transparenzmaßnahmen des EU-Registers eingesetzt haben. Das schrieb Nina Katzemich von Lobbycontrol in ihrem Buch „LobbyPlanet“, das dem Themenkomplex Lobbyismus mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bringen soll.
Laut Angaben seitens US-Regierung und Hightech-Industrie sei das Hauptinteresse für Lobbyarbeit in der EU, das digitale Umfeld bereitzustellen, um Endverbrauchern innovative Produkte zu bieten. Gleichzeitig gehe es um die Schaffung von Arbeitsplätzen - ein Argument, das Druck macht. Denn je mehr Arbeitnehmer ein Konzern im EU-Raum beschäftigt, desto größer ist sein Machtanteil bei Versuchen, seine Ziele durchzuboxen. Facebook-Cheflobbyistin Erika Mann hat für ihren Kunden massive Kritik an der geplanten Datenschutzreform vorgebracht. Beim jährlichen Datenschutztag am 28. Jänner erklärte sie, dass bestimmte Geschäftsmodelle - wie auch jenes von Facebook - dadurch gefährdet seien.
[h=2]Transparenzregister scheitert[/h]Ein etwas eigenwilliger Wesenszug von Lobbying ist, dass die Tätigkeiten meist hinter verschlossenen Türen ablaufen. Nach außen dringen sie nur im Falle von Machtmissbrauch. So erneuerte die EU-Kommission Mitte 2011 das Lobbying-Transparenzregister, dem Unternehmen regelmäßig Bericht erstatten sollen. Die Realität sieht aber eher enttäuschend aus. Laut Berichten von EU-Observer haben sich nach einem Jahr noch 120 in Brüssel lobbyingbetreibende Konzerne - unter anderem Apple, die Deutsche Bank und Goldman Sachs - nicht im Register eingetragen.
Etwa 50 registrierte Unternehmen behaupten laut dem Onlinemagazin EUobserver, weniger als einen Euro pro Jahr für Lobbying zu veranschlagen. Kritiker sprechen von einem mehr als lückenhaften Bild des Lobbyingtreibens in Brüssel. Im ersten Jahresbericht Ende 2012 zeigte sich der verantwortliche EU-Kommissar Maros Sefcovic allerdings zufrieden mit dem Ergebnis - zumindest gegenüber dem früheren Lobbyingregister der Kommission. Enttäuschend ist jedoch das Ergebnis aus Sicht des Versprechens. Das Ziel sei damals ein „de facto“ verpflichtendes Register gewesen.
[h=2]Eintrag muss verpflichtend sein[/h]Nun fühlen sich Unternehmen weder zur Registrierung verpflichtet, noch sind die Angaben zufriedenstellend. Was bei den Daten nämlich fehlt, sind etwa Angaben zum Gebiet, auf dem Lobbying betrieben wird, oder eine Erklärung zu offensichtlich zu geringen Lobbyinginvestitionen.
Dass der Eintrag ins Transparenzregister auf freiwilliger Basis erfolgt, lässt das ganze Projekt zur Farce verkommen, kritisieren etwa die Betreiber der deutschen Website Lobbycontrol. Die EU-Kommission müsse davon überzeugt werden, dass das Register erst durch eine verpflichtende Teilnahme und ernstzunehmende Sanktionen für falsche Angaben sinnvoll ist.
[h=2]Neues Lobbyinggesetz in Österreich seit Jänner[/h]In Österreich ist seit 1. Jänner 2013 ein Lobbyinggesetz und damit der erste Teil des Transparenzpakets in Kraft. Der Eintrag in das Verzeichnis soll durch Anreize wie erleichterte Zutrittsberechtigungen ins Parlament attraktiver werden. Das Register würde laut Wirtschaftskammer so eher von den Unternehmen angenommen und somit auch zu einer höheren Transparenzquote führen.
Lobbyisten seien anhand ihres eigenen Parlamentsausweises - wie bereits in Deutschland, Belgien, der Schweiz und den Niederlanden üblich - dann auch als solche erkennbar. Gemäß dem Lobbyinggesetz müssen auch Rechtsanwälte, Notare und Wirtschaftstreuhänder Lobbyingtätigkeiten anmelden, sobald ihre Arbeit Einfluss auf politische Entscheidungsträger nimmt.
[h=2]Links:[/h]
- EU-Parlament
- EU-Kommission
- Datenschutznovelle
- Politico
- EU-Transparenzregister
- Google im Transparenzregister
- Facebook im Transparenzregister
- EUobserver-Bericht
- Lobbycontrol
- Lobbying-Gesetz in Österreich
US-Lobbyisten zieht es nach Brüssel - news.ORF.at
5. 2. 2013 - 14:25 Uhr [h=1]Lobbying um europäische Musiklizenzen[/h] Die geplante europäische Regelung für Verwertungsgesellschaften und Rechtstatus von "nutzergenerierten Contents" verläuft erwartet kontroversiell.
Am Montag hat die EU-Kommission ihre Initiative "Lizenzen für Europa" gestartet. Diese Hearings zur einheitlichen Regelung der Urheberrechtsvergütungen in Europa begleiten eine Richtlinie, die Rahmenbedingungen dafür schaffen soll, dass europäische Firmen, Produzenten und Musiker ihre Werke überhaupt erst in anderen EU-Staaten vermarkten können.
Im Musikbereich gibt es für europäische Labels zum Beispiel überhaupt keinen europäischen Markt, quer durch Europa verkaufen sich nur die Angebote der Majors, der großen Labels aus den USA.
[h=2]Beispiel Musikmarkt[/h]Für die nach Staaten segmentierten, sehr kleinteiligen europäischen Musikangebote stellen schon die völlig unterschiedlichen Berechnungsmodi und -modelle für Lizenzen eine schwer überwindbare Hürde dar.
Der Umstand, dass die Zusammenarbeit der jeweiligen Verwertungsgesellschaften quer durch Europa bis dato überhaupt nicht funktioniert, macht derartige Geschäftsmodelle bis jetzt aussichtslos.
[h=2]Konsumenten, Kreatoren[/h]Diese überfällige Initiative der Kommission für Europäische Lizenzen zur Schaffung eines gemeinsamen Markts geht aber weit über den Musikbereich hinaus.
Die Entwicklungen der letzten Jahre haben im Netz etwa eine ganz neue Art von "Werken" hervorgebracht, deren Urheber aber wurden bis jetzt ausschließlich als "Konsumenten" kategorisiert. Die Rede ist vom sogenannten "User Created Content" in Sozialen Netzen, einem der vier großen Themenfelder, die in dem Hearing abgehandelt werden.
[h=2]Stakeholder Berlusconi[/h]Während aus den anderen Themengruppen noch nicht viel zu erfahren war - es gab weder Videostreams, noch Stellungnahmen auf der EU-Website - traf das auf das Arbeitsfeld drei, "Benutzerbestimmte Inhalte" nicht zu.
Die Bürgerrechtsgruppe La Quadrature du Net hatte bereits im Vorfeld die Liste der geladenen "Stakeholder" oder "Interessensträger" veröffentlicht.
Von Berlusconis Mediaset bis zur International Federation of Phonographic Industries (IFPI) sind etwa dreißig verschiedene Großunternehmen aus dem Mediensektor bzw. ihre Lobbies vertreten. Allesamt halten sie von "nutzergenerierten Inhalten" prinzipiell nicht viel, weil sie den Nutzern ja ihre eigenen Bezahlinhalte verkaufen wollen.
[h=2]Wer noch dabei ist[/h]Neben den flächendeckend repräsentierten privaten Medienindustrien stellen Google, Microsoft, eBay usw. ein halbes Dutzend Teilnehmer aus dem IT-Segment. Ebensoviele kommen je aus dem öffentlichen Sektor wie das British Film Institute bzw. aus dem Creative Commons- und Bürgerrechtsbereich.
Geleitet wird die Themengruppe von Maria Martin-Prat, nunmehr Topjuristin der Kommission in Urheberrechtsfragen. Davor hatte sie einen vergleichbaren Posten innegehabt - als oberste Juristin für die IFPI, den Lobbyverband der weltweiten Musikindustrie. Mit der Rede von Binnenmarktkommissar Michel Barnier, in der die anstehenden Probleme ziemlich ausgewogen dargestellt wurden, hatte der weitere Verlauf der Sitzung dann wenig zu tun haben.
[h=2]Lobbyisten, Grant[/h]Von Jeremie Zimmermann, dem wortgewaltigen Frontmann von La Quadrature kamen zunehmend grantige Tweets über "Zeitverschwendung" aus der Veranstaltung, weil dort so überhaupt nichts Zukunftsweisendes zu hören war.
Vielmehr trug ein Vertreter der Medienindustrie nach dem anderen die bereits sattsam bekannten Positionen vor. Wie auch rund um die Novellierung des europäischen Datenschutzes nicht zu übersehen war, haben diese beiden Vorhaben ganze Heerscharen von Lobbyisten angezogen.
[h=2]Deutsche Bundesliga, Print[/h]Entgegen anderslautenden Medienbereichten sind es keineswegs nur Lobbies der amerikanischen Unterhaltungsindustrie, die da die Trommeln für ihre Geschäfte rühren. Das Bertelsmann Media Group Rights Management, der "Deutsche Fußballbund und Bundesliga", Berlusconis Mediaset oder die "European Newspaper Publishers' Association" lassen sich wohl schwerlich den USA zuordnen.
Die genannte Tageszeitungslobby ist gleich doppelt, nämlich im Status eines "Stakeholders" wie auch als Beobachter vertreten, daneben auf der Liste steht die Lobby der europäischen Printmagazine.
[h=2]"Holzverarbeitende Medienindustrie"[/h]Das reichlich präsente Printsegment komplettieren dann noch die Hardwarelieferanten. Als wollte man den Spottdrosseln des Internets Genüge tun, die Printverlage als "holzverarbeitende Medienindustrie" bezeichnen: Auch die Assoziation der europäischen Papiererzeuger CEPI hat so starkes Interesse an "nutzergenerierten Inhalten" im Internet, dass sie beobachtend vertreten ist.
Die Heerscharen der Lobbyisten können sich die Abreise aus Brüssel zwischendurch eigentlich sparen. Die nicht minder umkämpfte Novellierung der EU-Datenschutzrichtlie wird nach dem Ministerrat gleich in fünf verschiedenen Parlamentsausschüssen gerade parallel behandelt.
Lobbying um europäische Musiklizenzen - fm4.ORF.at
Cu
Verbogener